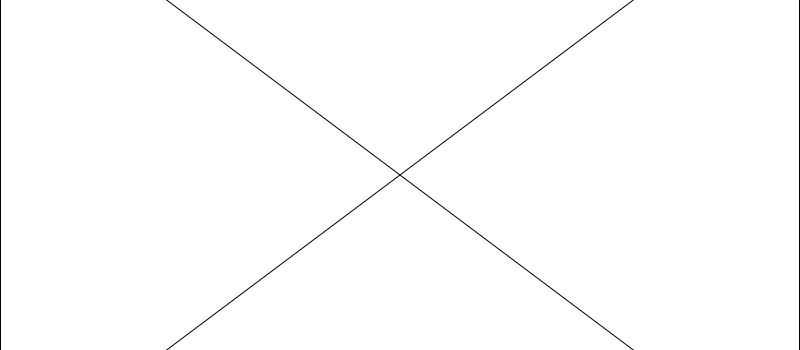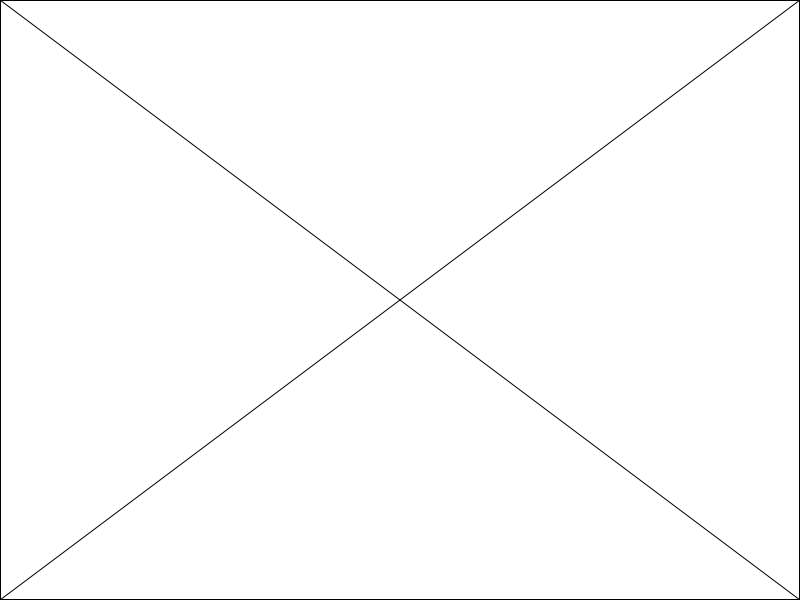Minia Biabiany: J’ai tué le papillon dans mon oreille.
Kunstverein Freiburg, Dreisamstr. 21, Freiburg.
Dienstag bis Sonntag 12.00 bis 18.00 Uhr, Donnerstag 12.00 bis 20.00 Uhr.
Bis 8. August 2021.
Der Bananenindustrie auf Guadeloupe ging es zuletzt nicht wirklich gut. Im Oktober 2017 hatte der Hurrikan Maria sämtliche Plantagen auf Grande-Terre, der östlichen Hauptinsel des schmetterlingsförmigen Archipels in der Karibik, dem Erdboden gleichgemacht. 600 Betriebe waren betroffen, die Ernteausfälle massiv. Dass sie anders als Nachbarländer wie die Dominikanische Republik binnen nur eines Jahres wieder auf dem Niveau der Vorjahre produzieren und so rund 250.000 Tonnen Bananen exportieren konnten, hat einen einfachen Grund: als einstige französische Kolonie, die 1946 zum Überseedépartment Frankreichs wurde, ist Guadeloupe Teil der Europäischen Union. Sonderprogramme stützen die Plantagenwirtschaft, die bis heute nahezu ausschließlich in der Hand der Nachkommen der weißen Kolonisatoren ist. Um den Pflanzern nach dem Hurrikan auf die Beine zu helfen, startete Frankreich im vergangenen Jahr eine Imagekampagne für die Guadeloupe-Banane als nationales Kulturgut und als Symbol der Nachhaltigkeit. Einer der Slogans lautete: „Égalité, Liberté, Biodiversité“.
Minia Biabiany nennt das, was die französische Agrarpolitik auf den Antillen fördert, einen Fake. Weder gehörten Bananen zur ursprünglichen Vegetation der Inselgruppe, noch könnten sie ohne massive Subventionen auch nur annähernd wirtschaftlich produziert werden. Die junge Künstlerin, die 1988 auf Guadeloupe geboren wurde und dort heute lebt, beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit den Spuren, die Kolonialismus, Sklaverei und eine Landwirtschaft der Monokulturen in der Natur und den Körpern der Menschen von Guadeloupe hinterlassen haben. Im Zentrum ihrer Einzelausstellung im Kunstverein Freiburg steht die Idee eines erzählerischen Geflechts.
Aus handelsüblicher Blumenerde auf den Boden gesiebt, wuchert hier ein gitterartiges Muster aus sechseckigen Grundformen bis in den letzten Winkel der Halle. Es ist den Reusen der karibischen Fischer nachempfunden. Leerstellen in der Struktur schlagen einen labyrinthischen Parcours durch den Raum vor, der die Elemente Feuer, Wasser, Wind und Erde miteinander verbindet. Er führt vorbei an von der Decke schwebenden Mobiles aus Holzlatten und in buntes Wachs getauchten Glasperlenketten, an großen, halb verkohlten Weidekörben, kreisrunden Teichen und geflochtenen Paravents, die entfernt an Ertragsgebirge aus ökonomischen Studien erinnern.
An den Wänden flackern zwei Videoarbeiten. Aus der Ferne klingt dazu der sonore Ton des Schneckenhorns – einer als Blasinstrument verwendeten Muschelart, mit der sich entflohene Sklaven auf Guadeloupe jahrhundertelang über das Wetter oder Gefahren durch die Kolonisatoren verständigten. Wie ein sanfter Tinnitus dehnt der Klang die Wahrnehmung der Ansichten regenverhangener Tropenwälder, brausender Quellen und zerschlissener Bananenstauden, die Biabiany in ihrem Video „Pawól sé van“ mit einem Langgedicht über die umfassende Verflechtung aller Dinge flankiert. „Ich habe den Schmetterling in meinem Ohr getötet“ lautet einer der Verse, der zugleich der Ausstellung ihren Titel gibt. Als Metapher für die Irritation der Sinne, die ein Insekt im Gehörgang auslösen kann, steht er für die Weitung des Blicks für das Unwahrscheinliche, Abseitige, Übersehene oder Unvorhersehbare.
Biabiany ließ sich für diese Arbeit von dem 2011 verstorbenen karibischen Philosophen Édouard Glissant und seiner Theorie der „Kreolisierung“ inspirieren, die davon ausgeht, dass aus unterschiedlichen Einflüssen immer wieder neue, offene und bewegliche Identitäten entstehen. Voraussetzung dafür ist die Begegnung, nicht die Abschottung. Kreolisierung beschreibt so gesehen das genaue Gegenteil der Gleichschaltung, auf die der Nationalismus und die Globalisierung auf unterschiedliche Weise abzielen.
Minia Biabiany übersetzt Glissants „Denken der Spur“ in ihren Arbeiten in eine sinnlich erfahrbare Raumerzählung voller zarter Farb- und Materialsensationen. Dass diese Spur immer zugleich eine Spur der Gewalt und des Zwangs ist, sickert hier ebenso sanft wie nachhaltig ins Bewusstsein. Tatsächlich erzählt die zerschlissene Bodenzeichnung aus gesiebter Erde geradezu exemplarisch von der Zerstörung der Lebensgrundlagen vieler durch die Profitgier weniger. So wurde auf Guadeloupe zur Ertragssteigerung der Bananenplantagen noch bis 2002 das in den USA bereits seit Mitte der 1970er Jahre und ternational ab 1990 verbotene Pestizid Kepone eingesetzt. Wichtiger Bestandteil dieses Gifts gegen den Rüsselkäfer ist das biologisch kaum abbaubare Molekül Chlordecon, das die Böden der Inseln und die Nahrungsketten der Menschen und Tiere verseucht. Zusammen mit der Nachbarinsel Martinique verzeichnet Guadeloupe heute die weltweit höchste Rate an Prostatakrebserkrankungen. Eine zynische Imagekampagne wie die für „La Banane Française“ erzählt so nicht zuletzt auch von den ganz realen, extrem toxischen Langzeitwirkungen kolonialer Herrschaft.