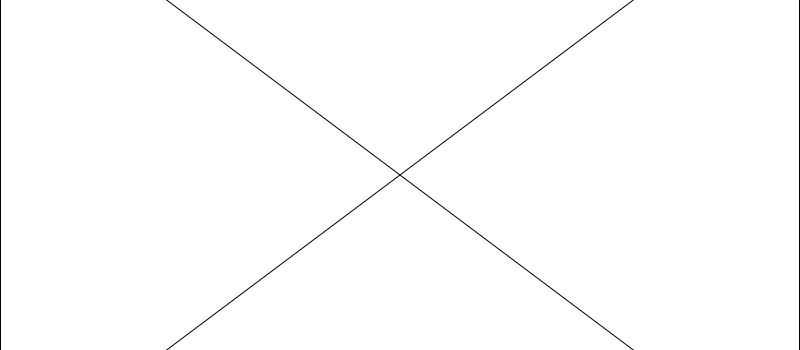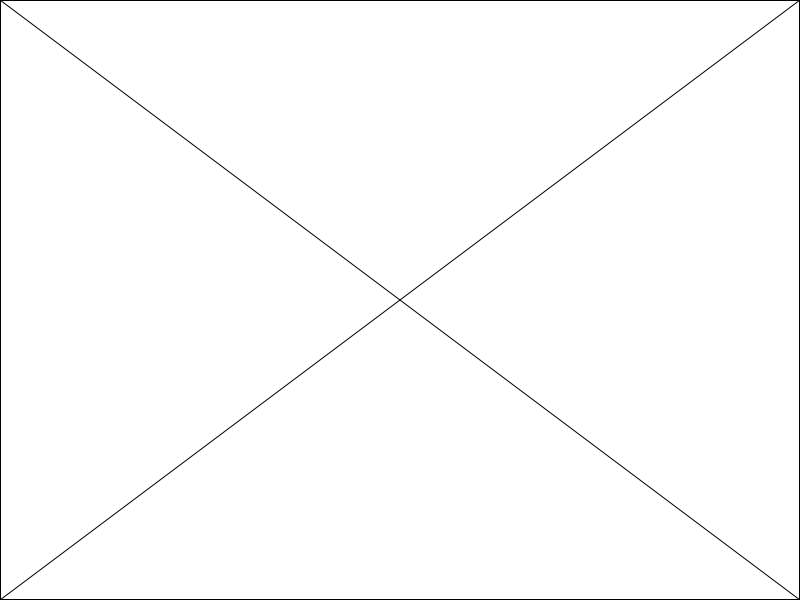Joachim Bandau: Die Nichtschönen.
Kunsthalle Basel, Steinenberg 7, Basel.
Dienstag bis Freitag 11.00 bis 18.00 Uhr, Donnerstag 11.00 bis 20.30 Uhr, Samstag und Sonntag 11.00 bis 17.00 Uhr.
Bis 6. Juni 2021.
Online-Interview mit dem Künstler unter www.kunsthallebasel.ch
Manchmal ist es eine Frage der Zeit, dass längst abgelegte, fast vergessene Dinge plötzlich eine ungeahnte Relevanz entfalten – oder zumindest ungute Erinnerungen wecken. Die eiserne Lunge ist so ein Objekt, Anfang der 1920er Jahre erfunden zur künstlichen Beatmung von lungenkranken Patienten, die nicht selten ihr gesamtes verbleibendes Leben in diesem sargähnlichen Apparat verbrachten. Er steht für das düstere Paradox des Überlebens zum Preis maximaler Unfreiheit. Bis zum Hals eingesperrt in die Unterdruckkammer, blieb Patienten mit chronischer Lungendysfunktion oft nicht einmal mehr die Möglichkeit der Selbsttötung.
Das bildhauerische Frühwerk von Joachim Bandau, das derzeit in einer umfassenden Einzelausstellung in der Kunsthalle Basel zu sehen ist, spielt mit diesem unauflösbaren Widerspruch zwischen Fürsorge und Freiheit, der prekären Balance zwischen Utopie und Dystopie. Dass viele der zwischen 1967 und 1974 entstandenen Arbeiten bislang nur selten oder noch nie gezeigt wurden, ist umso überraschender, als sie schon vor einen halben Jahrhundert keinen Hehl aus ihrer Nähe zur Popkultur, zum Surrealismus-Hype der Siebziger oder den futuristischen Settings des zeitgenössischen Sci-Fi-Kinos machten.
In der Kunsthalle Basel bevölkern die Plastiken Bandaus die Säle nun wie stumme Zeugen aus der Geschichte der Zukunft, unentschieden zwischen Humor und Horror. Dass ihnen trotz ihres hochglanzlackierten und spiegelverchromten Finishs etwas zutiefst Menschliches anhaftet, ist kein Zufall. Viele sind zusammengesetzt aus Kleiderpuppenfragmenten – oft Schulterpartien, Nacken- oder Kniestücken –, die er mit glasfaserverstärktem Polyester beschichtete und an den Querschnittkanten so zu klobigen Volumen verlängerte, dass sie mal wie Stelen in die Höhe wachsen, mal zu seltsam sinnlosem Mobiliar im Look von Bootseinbauten, Messgeräten oder Küchengeräten mutieren oder zu Wellen erstarren wie das Bodenrelief „Ophelia, badewassergrün“.
Ihre eigentümliche Körperlichkeit verdankt sich der Materialität von Haut über Fleisch über Knochen, die ihre Oberflächen nachbilden. Manche Partien deuten Schenkel oder Brüste an, aus denen Schläuche wuchern, andere wirken wie Relikte brutaler Verstümmelungen: Geschlechtslose Körper ohne Arme und Beine, versehen mit Handgriffen oder Gummirollen als mechanische Surrogate des menschlichen Bewegungsapparats. Diese „Nichtschönen“, wie Bandau seine frühen Arbeiten nennt, machen den Körper zur Bühne zum Nachdenken über Fragen des medizinischen Fortschritts und des Wertes menschlicher Arbeitskraft in der automatisierten Industrie des Spätkapitalismus, über Schönheit, Verletzlichkeit oder durch Kriegsinvalidität und Fortschrittsglauben inspirierte Hybridformen zwischen Mensch und Maschine.
Die Dramaturgie dieser sehenswerten Soloschau kennt kein Happy End. Auch wenn der heute 85-Jährige zwischendurch ein elektronisch gesteuertes Ballett aus selbstfahrenden Objekten durch den Ausstellungsraum tanzen lässt, wie er es 1977 in ähnlicher Form an der documenta 6 präsentiert hatte, warten im letzten Saal düstere Arbeiten wie die glänzende Sarkophagplastik „Schwarzes ruhendes Schlauchmonstrum“ oder „Weißes Duschtor“, entstanden kurz nach Ende der Auschwitzprozesse. Das Grauen des 20. Jahrhunderts bleibt auch im späteren Werk des gebürtigen Kölners anwesend – von den durch Paulo Virilios legendäre Studie über die Nazi-Bunker des Atlantikwalls inspirierten Betonplastiken der 1970er Jahre bis zu monumentalen Bodenskulpturen wie „Großes Bleimeer“ aus Hunderten bleiummantelten Holzschollen.