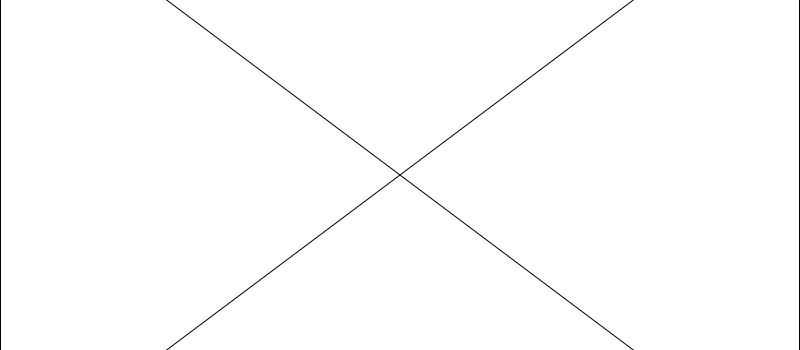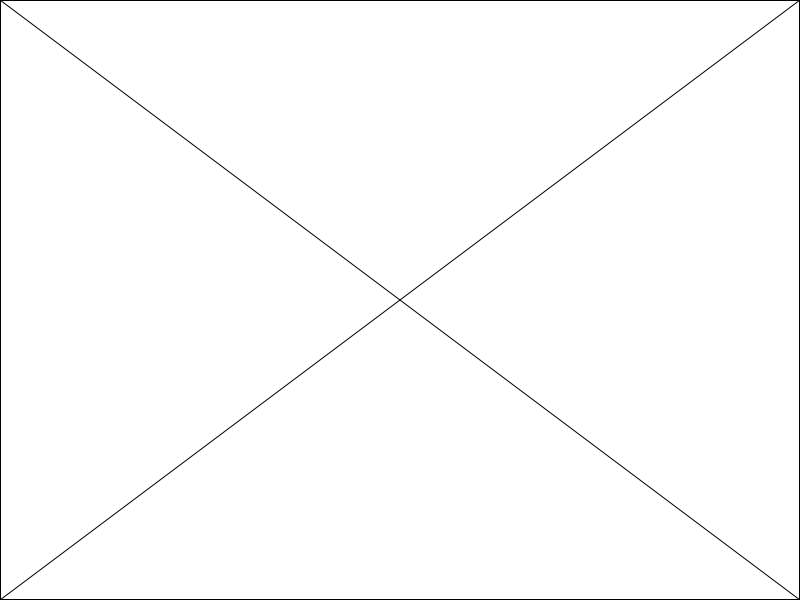Fiktion Kongo. Kunstwelten zwischen Geschichte und Gegenwart.
Museum Rietberg, Gablerstr. 15, Zürich.
Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 17.00 Uhr, Mittwoch bis 20.00 Uhr.
Bis 15. März 2020.
Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen: Scheidegger & Spiess, Zürich 2019, 328 S., 48 Euro | ca. 49 Franken.
„Zu dumm, dass ich kein eigenes Auto habe“, notierte Hans Himmelheber (1908–2003) am 14. Januar 1939 in sein Tagebuch. „Ich weiß, dass hier nichts zu holen ist, aber ich klebe fest ….“. Seit neun Monaten war der deutsche Ethnologe im Kongo unterwegs und kaufte Kunst im Auftrag europäischer und amerikanischer Sammler und Museen. Sein Enthusiasmus war groß, seine Ernte reichhaltig – auch wenn er beim Transport der Artefakte immer auf Mitfahrgelegenheiten von Missionaren, lokalen Chiefs oder Kolonialbeamten angewiesen war. Auf Märkten und in Künstlerwerkstätten erwarb er Tausende von Masken, Skulpturen und Kultobjekten. Als er Ende Januar 1939 dann endlich ein eigenes Auto erstand, vergrösserte sich sein Aktionsradius schlagartig. Ein Foto, das Himmelheber kurz darauf aus dem Autofenster machte, zeigt drei junge Männer in der Pende-Region, gut 1000 Kilometer östlich der Atlantikküste, die ihm eine Maske mit Bastmähne präsentieren. Es ist dieselbe Maske, die derzeit in der sehenswerten, von Michaela Oberkofler und Nina Guyer kuratierten Ausstellung „Fiktion Kongo“ im Zürcher Museum Rietberg zu sehen ist, zusammen mit rund 100 historischen Objekten sowie Arbeiten von gut einem Dutzend zeitgenössischen Kunstschaffenden.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion zu Fragen der Restitution von Objekten, die aus einem kolonialen Kontext den Weg in europäische Museen fanden, entwickelten die Kuratorinnen die Idee einer kritischen Revision der umfangreichen, vielfach über Himmelheber erworbenen Bestände kongolesischer Kunst im Museum Rietberg durch Künstlerinnen und Künstler der aktuellen Szene Kongos. Im Zentrum steht dabei der in Tagebüchern und über 1500 Fotografien dokumentierte Blick Himmelhebers auf die Menschen und ihre Kultur, mit deren Erforschung und Vermarktung er auf dem Höhepunkt der kolonialen Ideologie seinen Lebensunterhalt bestritt. „Himmelhebers Fotos offenbaren einen faszinierenden Widerspruch“, schreibt der Videokünstler und Komponist David Shongo (*1994) im umfangreichen Katalog zur Ausstellung. „Obwohl es ihm ganz offenkundig um die abgebildeten Kunstwerke und Menschen geht, ist sein kolonialer Blick unverkennbar“. Shongo überlagert diese stereotypische Perspektive in seiner Arbeit „Blackout Poetry, Idea’s Genealogy“ mit Strichcodes und Leiterplattenornamenten, die nun viele der vorgeblich aus wissenschaftlichem Interesse aufgenommenen Halbakte junger Frauen und alter Männer als rassistische oder sexistische Projektionen markieren und ganz nebenbei die Kontinuität der Ausbeutung in den Blick nehmen – etwa in den Coltan-Minen für die Produktion elektronischer Geräte. Auch die im französischen Nevers lebende Michèle Magema (*1977) verwendet Fotografien von Himmelheber als Vorlage. In ihrem Zyklus „Evolve“ setzt sie sich mit der Geschichte ihres Großvaters auseinander, der 1938 im Kongo eine Stelle bei der Kolonialverwaltung annahm und so als „évolué“ zur kleinen Schicht der Bildungsaufsteiger gehörte. Das unauflösbare Dilemma eines Lebens zwischen Loyalität und Demütigung thematisiert Magema in einer Reihe von Strichzeichnungen, in denen die Körper der Porträtierten zugleich wie maßgeschneiderte Gefängnisse ihres freien Geistes erscheinen. Eine extravagante Art des Ausbrechens aus diesem Käfig der Zuschreibungen zelebrieren seit Ende der 1970er Jahre die Sapeurs, eine kleine Szene von mittellosen Fashionistas und Dandys, die Mode als Waffe nutzen für ihren Aufstand der Eleganz gegen die Unsichtbarkeit, welche die Armut produziert. Ihnen widmen Yves Sambu (*1980) und Fiona Bobo (*1992) im Museum Rietberg je eigene Arbeiten, die sich ebenso als gut gelaunte Kritik an Himmelhebers Liebe zum angeblich Authentischen afrikanischer Kunst verstehen lassen wie auch als Verneigung vor Studiofotografen wie Antoine Freitas, dessen Porträts von Schwarzen aus den 1930er Jahren eine Utopie des guten, bürgerlichen, afrikanischen Lebens entwarfen. Hans Himmelheber konnte dieser Utopie nichts abgewinnen, nannte sie „unfrei“ und „Pseudokultur“. Vielleicht weil er bereits ahnte, dass die Ursprünglichkeit, an die er glaubte, die eigentliche Fiktion war.