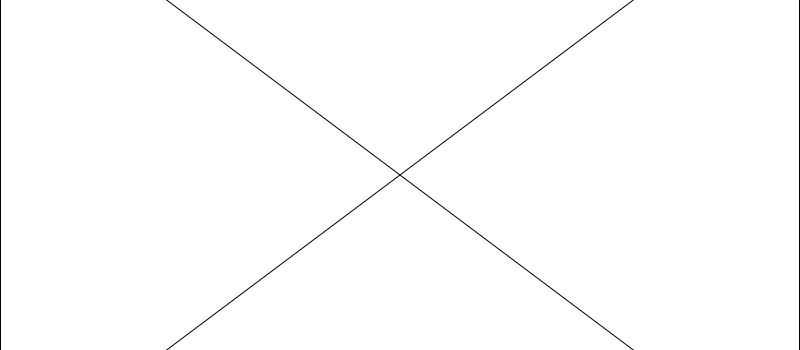Diamond Stingily: Wall Sits.
Kunstverein München, Galeriestr. 4, München.
Dienstag bis Sonntag 12.00 bis 18.00 Uhr, Donnerstag 12.00 bis 21.00 Uhr, an Feiertagen geschlossen.
Bis 23. November 2019.
Hat die neue Leiterin des Münchner Kunstvereins, Maurin Dietrich, die Sicherheitsmaßnahmen verschärft? Weil nun im ersten Stock hohe Eisengitter vor den Fenstern hängen. Und warum sind die Fenster mit Zeitungspapier beklebt? Ist vielleicht hier ein Umbau am Laufen? Tatsächlich stehen im Haus Veränderungen an. So wird etwa das „Kino“, das Chris Fitzpatrick einbauen ließ, in einen Archiv- und Arbeitsraum umgewandelt. Gitter und Zeitungen haben aber trotzdem einen anderen Grund. Und zwar „Wall Sits“: die erste Einzelausstellung von Diamond Stingily in Europa, welche gleichzeitig die erste Schau unter der neuen Leitung ist. Stingily wurde 1990 in Chicago geboren, ist eine afroamerikanische Künstlerin und Poetin und greift in ihren Werken Themen wie Identität, Mythologie, (afro-)amerikanische Geschichte, Familie und Kindheit auf.
„Outside“ heißt die Arbeit mit den Gittern und den Zeitungen, die man tatsächlich nicht sofort als Teil der Ausstellung erkennt. Und zwar schon deshalb, weil die Fenster im ersten Stock des Kunstvereins weit oben sind. Was man aber bemerkt, dass ist die abgedimmte Lichtstimmung, die durch die Zeitungen im großen, mittleren Ausstellungssaal entsteht. Inspiriert ist „Outside“ von Kindheitserinnerungen und den Erfahrungen in einer amerikanischen Großstadt, wo solche, in der Regel vor Geschäfts- und Wohnräumen im Erdgeschoss angebrachte Eisengitter nichts Ungewöhnliches sind. Sie sollen Diebe, unerwünschte Eindringlinge draußen halten. Eine Situation, die sich im Ausstellungsraum verkehrt. Auch Zeitungen an Fenstern kennt man als Zeichen für geschlossene Räume, etwa wenn es in Geschäften einen Umbau oder einen Besitzerwechsel gibt.
Schutz sollten genauso die fünf ausrangierten Türen einmal bieten, die nun abgenutzt, funktionslos unter dem Titel „Entryways“ herumstehen. Und wenn ihr Schutz nicht ausreichte, wären noch Baseballschläger da, wie sie nun an den Türen und in der Ecke lehnen. So hat es jedenfalls Stingily in Erinnerung: dass es bei ihrer Großmutter immer einen Baseballschläger gab, zur Abwehr von Bedrohungen, denen sie als Schwarze in Chicago ausgesetzt war. Ebenfalls eine typisch afroamerikanische Erinnerung: dass kein Geld für Spielzeug da war. Deswegen musste Stingily als Kind statt eines Springseils Telefonschnüre benutzen. Solche „Double Dutch Ropes“ hängen im letzten Saal nun an der Wand und machen indirekt Klassenverhältnisse zum Thema.
Die größte, den Mittelsaal einnehmende Arbeit ist „In the Middle but in the Corner of 176th Place“. Auf vier Regalreihen sind mehr als 700 Sport-Trophäen versammelt. Man sieht Baseball-, Football- oder Tennisspieler, Pokale, Vögel, Sterne oder was es sonst als Siegeszeichen gibt. Die Figuren, Sockel und Textfelder wiederholen sich, in unzähligen Variationen, wobei die Texte das Besondere sind. Von Siegen ist dort nämlich nichts zu lesen, stattdessen gibt es Aufmunterungssprüche oder Eingeständnisse des Scheiterns: „I did the best I could with what I had“. „It was for the glory“. „And that‘s it“. Auch hier existiert ein familiärer Hintergrund, da zwei Brüder von Stingily in der Football-Profiliga spielen. Sport, das war einer der ersten Bereiche, über die Schwarzen ein gesellschaftlicher Aufstieg möglich war. Die Kunst, sie mag ebenfalls ein solcher Weg sein, aber auch ein Mittel, um über Fragmente, Bestandteile der eigenen Biografie den strukturellen, noch immer vorhandenen Rassismus, um Ausgrenzung und Marginalisierung zu thematisieren. Diamond Stingily macht das nicht plakativ, sondern subtil, mit einer originellen, sehr persönlichen und zugleich alltagsnahen Bildsprache.