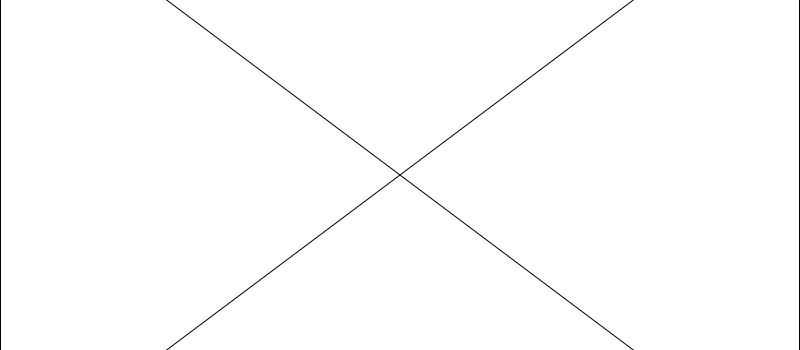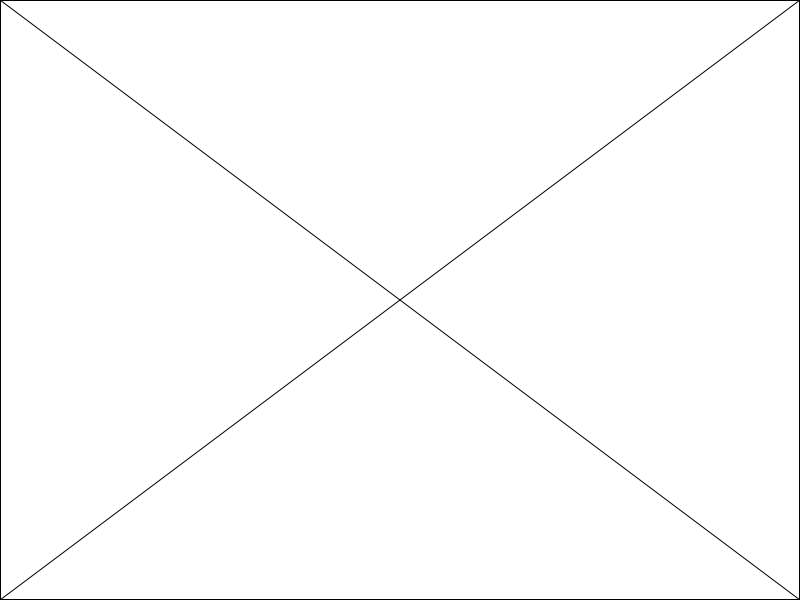Samuel Fosso: Der Mann mit tausend Gesichtern.
Walther Collection, Reichenaustr. 21, Neu-Ulm.
Donnerstag bis Sonntag 14.00 bis 17.00 Uhr.
Bis 18. November 2022.
www.walthercollection.com
Reenactment bezeichnet die akribische Rekonstruktion eines historischen Zeitpunkts, eines Bildes, Ereignisses oder Artefaktes. In der Bildenden Kunst ist das zwar kein neues Prinzip, hat aber in der Fotografie eine neue Bestätigung als kulturelle und performative Zeitmaschine erfahren. Geht man durch die Ausstellung „Samuel Fosso – Der Mann mit tausend Gesichtern“ in der Neu-Ulmer Walther Collection, so begreift man leicht, was das bedeutet. Fosso verkleidet sich als Papst, als Mao Tse-tung, als Malcolm X oder als Soldat des Ersten Weltkrieges, macht sich Posen und Mimik zu Eigen, imitiert und adaptiert präzise. „Verkleiden“ wäre allerdings ein zu kurz greifender Begriff für die Genauigkeit, mit welcher der 1963 in Kamerun geborene Künstler seine Nachbildungen ikonischer Bilder und Fotografien umsetzt. Farbgebung, Beleuchtung, jedes kleinste Detail sitzt perfekt und so merkt man fast nicht, wenn er signifikante Details manipuliert. Etwa im Portrait des chinesischen Parteiführers Mao Tse-tung: erst unmerklich, dann aber geradezu herausstechend ist es nicht die chinesische Landkarte, die man im Hintergrund auf der Fahne sieht, sondern die afrikanische. Ein ebenso politisch zu lesendes Statement wie auch ein persönliches: Schon mit 13 Jahren, als Fosso in Bangui ein erstes eigenes Fotostudio eröffnete, begann er die Adaption ikonischer Bilder als Spielform des eigenen Ichs zu nutzen. Die Ausstellung bildet im Obergeschoss jenes Atelier nach, in dem Fosso nach Feierabend nicht nur das eigene Ich in hunderte von Transformationen sandte, sondern das er auch zu einem Treffpunkt der Kunstszene machte. Künstler*innen aller Sparten kamen zu ihm, ließen sich inszenieren, man tauschte sich aus. Ein Blick auf die Kleidungsstücke, die sich Fosso nach Vorlagen aus internationalen Modemagazinen nachschneidern ließ, und man ahnt schnell: Diese Szene in Bangui war genau im Bilde, was in Kunst, Mode, Design und Musik dieser Jahre en vogue war.
Und doch blieb Fosso von 1975 bis 1994 unterm Radar der internationalen Kunstszene. Er sah sich als Gebrauchsfotograf, der mit geschäftlichem Sinn seine Studios betrieb und für sich selbst Autoportraits in immer wechselnden künstlerischen Impulsen ersann. Und während die erfüllten Teenagertage – die Fosso rückblickend selbst als eine sehr glückliche Zeit beschreibt – in der Ausstellung gut erfasst sind, bleiben die 1980er ein weißer Fleck. Als Samuel Fossos Entdecker und Förderer darf der Kurator und Documenta 11-Leiter Okwui Enwezor gelten, der Fosso auch für die Walther Collection erschloss und dem die aktuelle Ausstellung gewidmet ist. Darin ein Schlüsselwerk des reifen Künstlers, der heute in Paris lebt: „SixSixSix“. 666 Mal fotografiert er sich selbst mittels Polaroid, um die zahllosen Ausdrucksvarianten des menschlichen Gesichts festzuhalten. 666 Fotografien von 1000 in einer Ausstellung, die den großen Bogen vom Frühwerk bis zur Gegenwart spannt, mit zum Teil sehr persönlichen Werkreihen. Etwa „Memoire d’un ami“, worin er an den Tod seines engen Freundes Tala erinnert. Fosso zeigt sich hier als er selbst, ohne Staffage, nackt vor einer verschlossenen Tür oder hineingekauert in einen Karton in einem engen, mit Müll vollgestellten Raum. „In meiner Arbeit bin ich kein Subjekt oder Objekt“, erklärt der Künstler, „ich bin ein menschliches Wesen. Ich leihe meinen Körper an diese Figur, den ich möchte deren Geschichte übertragen“.
Es ist deutlich, dass Fosso mit der gelegentlich als konzeptuelle Verwandte zitierten Cindy Sherman wenig gemein hat. Während es ihm strukturell um das Leiden der anderen geht, um politische und gesellschaftliche Prozesse, erschöpft sich Sherman in eitlem Bombast. Fosso hingegen ist wunderbar spielerisch, experimentell, eigenwillig. Die „TATI“-Reihe legt gewitzt offen, wie viel unsere Gegenwart der schwarzen, ja, auch der afrikanischen Kultur schuldet. Und ein letzter Gedanke: Auf wohltuende Weise bleibt Fosso in der Technik klassisch. Es ist seine Imagination, das minutiöse Setting und eine analoge Kamera, die die Magie seiner Arbeit herstellen.