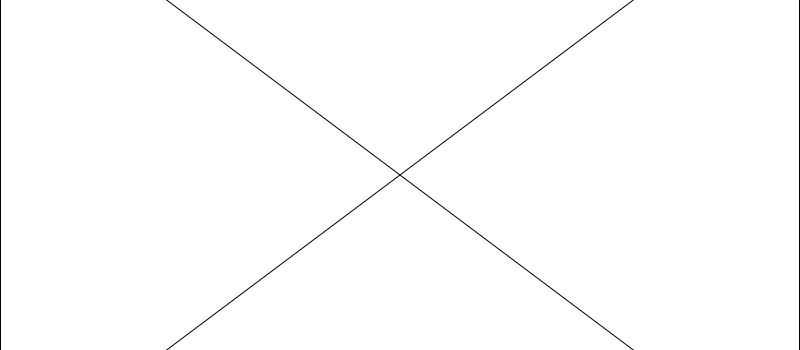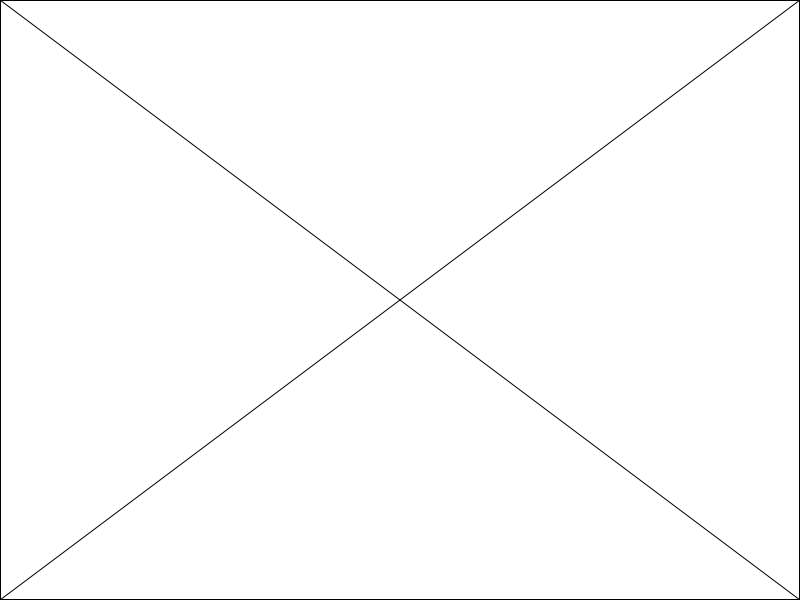Jean-Frédéric Schnyder.
Kunstmuseum Bern, Hodlerstr. 12, Bern.
Dienstag 10.00 bis 21.00 Uhr,Mittwoch bis Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr.
Bis 15. Mai 2022.
www.kunstmuseumbern.ch
Kunsthalle Bern. Helvetiaplatz 1, Bern.
Dienstag bis Freitag 11.00 bis 18.00 Uhr, Samstag 10.00 bis 18.00 Uhr.
Bis 15. Mai 2022.
kunsthalle-bern.ch
„Ich nenne ihn den grossen Eigensinnigen“, sagt Kathleen Bühler, Chefkuratorin am Kunstmuseum Bern. Das Museum präsentiert rund 65 mehrheitlich frühe Werke von Jean-Frédéric Schnyder. Dabei konnte das Team aus dem Vollen schöpfen. Rund 170 Werke gingen durch zwei Schenkungen des 2010 verstorbenen, legendären Galeristen Toni Gerber an die Berner Institution. Das Kunstmuseum lud Schnyder ein, die Arbeiten selbst zu arrangieren. „Ich habe die Auswahl den Räumlichkeiten angepasst“, sagt der Künstler lapidar. Das grosse Theoretisieren ist seine Sache nicht. Auf die legendäre, von Harald Szeemann 1969 kuratierte Schau „When Attitudes Become Form“ angesprochen, in der er unter anderen Avantgardisten mit dabei war, sagt er lediglich: „Das ist schon lange her. Man kannte sich halt.“ Schliesslich schiebt er doch noch nach. „Es war eine gute Zeit.“ Viel sei damals von auswärts gekommen. „Man bekam die grosse weite Welt serviert“, sagt Schnyder, der 1945 in Basel geboren wurde und in Bern aufwuchs. Natürlich habe das an Szeemann gelegen, der die Leute nach Bern holte.
Die Ausstellung im Kunstmuseum Bern beginnt kindlich verspielt. In Vitrinen stösst man auf Schnitzereien, die der Künstler aus gefundenen Stecken schuf. Schnyder ist Bastler und Denker in einem. Wie sorgfältig umgesetzte Geistesblitze kommt seine frühe Kunst daher. Sein „Kapitän“ von 1973/74 ist ein Skelett aus Weinkorken, wobei er für die Hüften Champagner-Korken verwendet hat und Knochenstücke den Kiefer bilden. Der morbide Kerl, dessen einstiger Beruf sich an der Kapitänsmütze erraten lässt, ist ein bissiges Memento mori: Mit jeder entkorkten Flasche nähern wir uns schliesslich ein Stück weit dem Tod, nicht weil der Alkohol so ungesund wäre, sondern ganz einfach, weil die Zeit vorbeigeht. Lange bevor es en vogue war, nutzte Schnyder Materialien, die man im Baumarkt kaufen kann, und nagelte etwa mit Sternnieten ein Herz auf Hartfaserplatte. Schnyder wirkt heutig in seiner Experimentierfreudigkeit. Um den guten Geschmack scheint Schnyder sich ebenfalls zu foutieren. Doch der gelernte Fotograf wandte sich Anfang der 1970er nicht mit Spott, sondern mit dem Furor des Amateurs der Malerei zu. Gemeinsam mit seiner Frau, der Künstlerin Margret Rufener, begann er die Werkserie „How To Paint“, die sich am Do-it-yourself-Malkurs von Walter T. Foster orientierte. Die beiden arbeiteten sich durch den Kurs und erschufen Clowns, Sexbomben und Sonnenuntergänge. Wie man sich diese Zusammenarbeit vorstellen muss? „Sie kann besser Menschen, ich kann besser Gegenstände.“
Er habe damals kein Atelier gehabt und sich deshalb für die Strasse entschieden. Mit einem Rennvelo und einer Staffelei erkundete er die Umgebung von Bern und schuf 126 Berner Veduten, die zur Grundlage für seine Karriere als „ernsthafter“ Maler wurden. Dabei malte er nicht nur Brücken und Kirchen, sondern auch mal ein modernes Gebäude mit einem Migros-Logo darauf. „So sieht es ja aus“, lautet seine knappe Antwort auf die Frage, was ihn dazu bewegte.
„Schnyders Werk erzählt viel über das Künstlersein und zeigt, dass dazu auch das Ausprobieren und Scheitern gehört“, sagt Bühler. Tatsächlich gibt es in der Schau Bilder, die davon zeugen, dass dem Maler der Geduldsfaden riss. Etwa wenn ein roter, aggressiv ausgeführter Pinselstrich die dargestellte urbane Zone fast durchzustreichen scheint. Eine Hauptrolle im Werk von Jean-Frédéric Schnyder spielt sein einstiger Hund namens Dritchi, den er in den 80er-Jahren springend, schlafend oder zwischen verschneiten Bäumen rennend verewigte. „Grosses Wasser“ bedeute der Name dieses tibetanischen Tempelhundes, der ein Familienmitglied gewesen sei. „Ich wollte ihn einfach mal abmalen.“ Schliesslich stellte er den Hund gar im Himmel dar und zwar als Maler – die wohl glücklichste Fügung, die der Künstler sich für ihn ausdenken konnte. Das Bild sei, was man sehe. „Ein Endpunkt.“ Aber: „Ich habe keine genaue Vorstellung von der geistigen Welt. Da kann ich nicht weiterhelfen.“