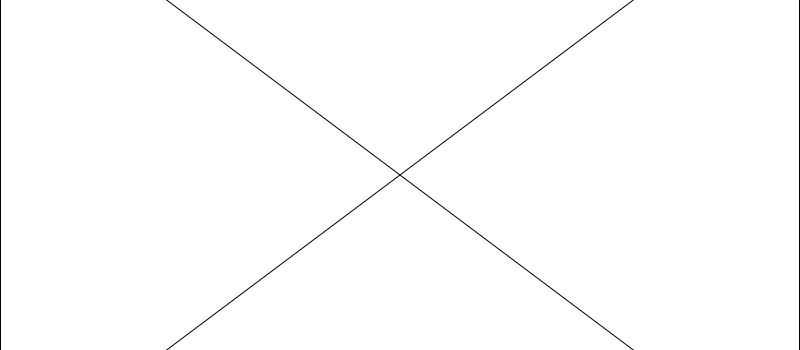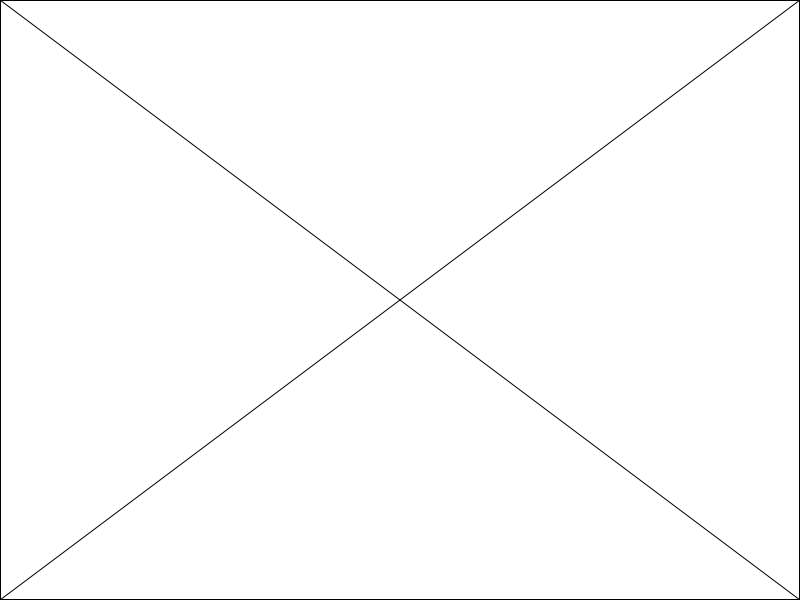Julian Rosefeldt: Manifesto.
Staatsgalerie Stuttgart, Konrad-Adenauer-Str. 30-32, Stuttgart.
Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr, Donnerstag bis 20.00 Uhr.
Bis 14. Mai 2017.
Museum Villa Stuck, Prinzregentenstr. 60, München.
Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr, Freitag 10.00 bis 21.00 Uhr.
16. Februar bis 21. Mai 2017.
Reste einer Aftershowparty vermüllen den Tisch, wer noch nicht schläft, ist bestimmt nicht nüchtern, die fertige Punk-Lady macht da keine Ausnahme. Betrunken fläzt sie auf dem Sofa und doziert über den Schöpfergeist des Menschen. „Let us honour the Avantgarde“. Die avantgardistische Energie im Raum reicht zwar gerade noch zum Knutschen und Koksen, doch die wahnsinnige Kraft der Worte, die aus der Frau mit dem dunklen Lidschatten strömen, leuchtet. Die Frage nach der Aufrichtigkeit der Kunst, nach der Wahrheit stellt sich heute ja nicht weniger dringend als 1920, als Naum Gabo und Anton Pevzner „Das realistische Manifest“ verfassten oder Vicente Huidobro „Wir müssen erschaffen“ forderte.
Deren Worte spricht diese Frau – und in ihrem Monolog zeigt sich tatsächlich, wie „bahnbrechend schön“ die Künstlermanifeste der frühen Moderne sind, denen Julian Rosefeldt ein ebenso bahnbrechend schönes Kunstwerk gewidmet hat, das derzeit in der Staatsgalerie Stuttgart zu sehen ist und ab Mitte Februar auch in der Münchner Villa Stuck. Rosefeldts Installation „Manifesto” besteht aus
13 Film-Sequenzen, die allesamt aus verschiedenen Original-Künstlermanifesten montiert sind und von Schauspielerin Cate Blanchett gesprochen werden; auf Screens in drei Räumen sieht man sie in diversen Rollen. Als Punkerin feiert sie den Kreationismus und fordert: „Man muss schöpferisch sein.“ Als Trauerrednerin lässt sie Dada aufleben („Die Logik ist eine Komplikation“), als Wissenschaftlerin den Konstruktivismus („Wir sind Schöpfer des Gegenstandslosen“). Und als despotische Choreografin triezt sie ihre Tänzer mit Fluxus-Texten: „Alles was ich sage ist Kunst ist Kunst.“ Cate Blanchett, darauf muss der Besucher vorbereitet sein, spricht englisch, eine Untertitelung gibt es nicht.
Die Diskrepanz zwischen Worten und Film-Setting kann einen herrlich ironischen Bruch ergeben, wenn Blanchett als konservative Mutter ein Pop-Art-Manifest von Claes Oldenburg als Tischgebet spricht: „Ich bin für die Kunst des Schweißes, der sich zwischen überkreuzten Beinen bildet.“ Der aggressiven Börsenmaklerin hingegen liegt der Geschwindigkeits-Eros der Futuristen durchaus: „Wir preisen die angriffslustige Bewegung, den Laufschritt“. Julian Rosefeldt meint es durchaus ernst. Die Texte, die er aus hunderten Manifesten herausgesucht hat, faszinieren ihn, weil sie geschrieben wurden, um etwas zu bewegen: „Die Arbeit ist ein Lehrstück dafür, dass man sehr wohl laut werden kann, wenn man etwas zu sagen hat“ – und das habe gerade in diesen Zeiten eine ganz neue Notwendigkeit.
Und so setzt er die ganze Verführungskraft des Films ein, um die Zuschauer zu erreichen. Die Szenen sind perfekt, mit fast pedantischer Liebe zum Detail eingerichtet, und im Spiel einer Blanchett schütteln die Zeilen tatsächlich den Staub der Kunstgeschichte ab. Dass er den charismatischen Weltstar gewonnen habe, sei Zufall, sagt der Künstler. Man habe sich in Berlin bei einer Vernissage kennengelernt und spontan beschlossen, etwas zusammen zu machen. In gerade mal elf Drehtagen entstand „Manifesto“. Gedreht wurde in und um Berlin.
Ob „Manifesto“ eine Art Gesang auf das womöglich gescheiterte Projekt der Moderne sei, fragte Christiane Lange, Direktorin der Staatsgalerie, den Künstler anlässlich der Eröffnung in Stuttgart. Rosefeldt aber möchte nicht den Kulturpessimisten geben und antwortet lieber mit einem Verweis auf jene Szene, die er als Epilog versteht. Cate Blanchett ist darin eine Grundschullehrerin, die ihren Viertklässlern Film-Dogmen in die Hefte diktiert („Es darf nur mit der Handkamera gedreht werden“). In diesem optimistischen Moment werde den Kindern die Zukunft übergeben, sagt Julian Rosefeldt. Was wäre das Manifest schließlich ohne ein bisschen Utopie: „Morgen beginnen wir gemeinsam mit dem Bau einer Stadt“.