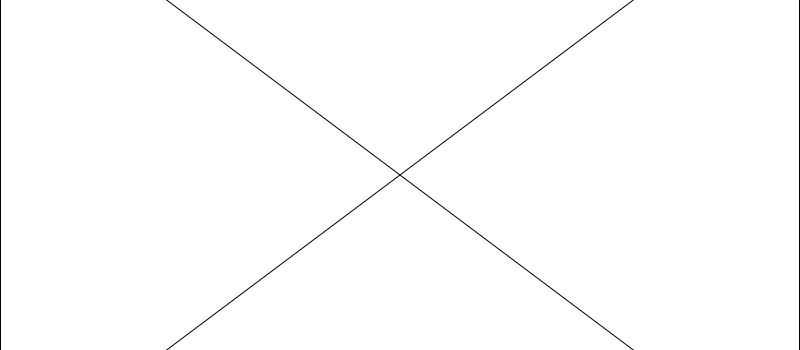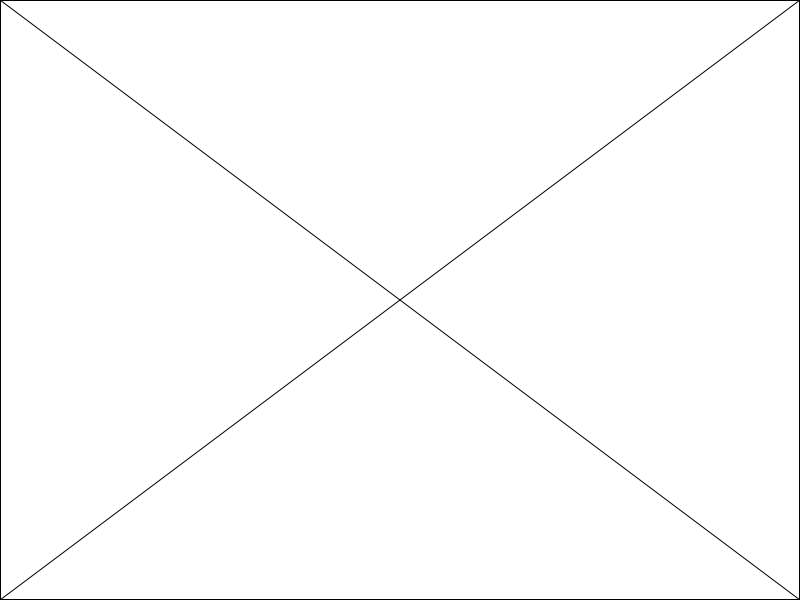Pavel Pepperstein: Die Auferstehung Pablo Picassos im Jahr 3111.
Kunsthaus Zug, Dorfstr. 27, Zug.
Dienstag bis Freitag 12.00 bis 18.00 Uhr, Samstag und Sonntag 10.00 bis 17.00 Uhr.
Bis 21. Mai 2017.
Picasso war ein Meister der Paraphrase. In seinem Spätwerk rekurrierte der spanische Künstler wiederholt auf Gemälde alter Meister. Picassos Paraphrasen lassen sich nicht nur als Hommage an die zitierten Künstler lesen, sondern sind zugleich ein bewusstes Kräftemessen. In der von Matthias Haldemann kuratierten Ausstellung „Pavel Pepperstein. Die Auferstehung Pablo Picassos im Jahre 3111“ geht der russische Künstler über das blosse Paraphrasieren hinaus: Pepperstein (*1966) erdichtet einen Bericht, wonach der 1973 verstorbene Pablo Picasso durch die Bemühungen eines Instituts für Medizinische Hermeneutik in Moskau wieder zum Leben erweckt worden sei. Gemäss dieser Fiktion habe der auferstandene Picasso die im Kunsthaus Zug ausgestellten Gemälde geschaffen, die mit „P.P.“ signiert und irrtümlicherweise auf das Jahr 3111 datiert sind.
Die provokatorische Geste, die den Arbeiten zugrunde liegt, ist unübersehbar: Pepperstein suggeriert, Picasso habe die Gemälde kreiert, die Peppersteins eigenem Pinsel entstammen. Latent schwingt dadurch die Frage nach dem Verhältnis zwischen Epigonentum und Eigenkreation mit. Innerhalb dieser Diegese spielt Pepperstein die Rolle von Picassos Schützling: Vom russischen Institut beauftragt, soll Pepperstein, als wahrer Künstler, mit Picasso schöpferischen Umgang pflegen, um seine künstlerischen Fähigkeiten zu reanimieren, die während seiner Zeit des Aufenthalts im Reich der Toten zum Erliegen gekommen seien. Der ausufernde Bericht, wiedergegeben auf 43 bedruckten, an die Wand gehängten DIN A4-Blättern und dokumentarisch angelegten Videoaufzeichnungen von am Experiment beteiligten Wissenschaftlern, führt geduldige Hörende und aufmerksam Lesende aufgrund der Seitenzahl der Texte in den richtigen Folgeraum der Ausstellung; diese selbst ist nämlich nur in einer räumlich diskontinuierlichen Reihenfolge zu erschliessen.
Gegliedert ist die Ausstellung in sechs Farbperioden, in die Picassos posthumes Oeuvre eingeteilt wird. Beginnend mit der grauen, stellt die rote Periode die Klimax der künstlerischen Produktion dar. Das resurrektale Schaffen endet mit der weissen Periode, in der Picasso, Peppersteins Narration zufolge, dessen Ikonographie der Kolobki – kreisrunde Strichgesichter auf weissem Grund – imitiere. Folgt man dieser Logik, trifft man zunächst auf Gemälde, die des fahlen Farbauftrags und ihres Bildvokabulars wegen an Picassos Frühwerk gemahnen. Peppersteins Protagonisten mit den hängenden Schultern und den schlaksigen Körpern könnten genauso gut aus Picassos Bildwelten der blauen und rosa Periode entspringen, wären da nicht die Euroscheine, die ostentativ in den Händen gehalten werden. In anderen Räumen begegnet man dagegen mythologischen Figuren und solchen aus der Commedia dell’Arte. Pepperstein verzichtet auch nicht auf die Inszenierung des klischeebehafteten Bildes von Picasso als libidinösem Frauenhelden und malt weibliche Akte. Dieses Potpourri aus Peppersteins Handschrift und der von Picasso entlehnten Motive machen die ikonographisch und semantisch überladenen Gemälde nur schwer dekodierbar: Griechische Mythologie trifft auf russische Bauernfolklore, eine doppelköpfige Matrjuschka steht auf einem Riesenfuss und die Zunge eines Stierkopfs formt sich zur nackten Europa, die von einer Lache aus roter Farbe umspielt wird, auf der russisch-konstruktivistische Elemente platziert sind.
Hat man den Hindernislauf im Museum bewältigt, fragt man sich, worin Peppersteins Absicht gründet: Geht es dem Künstler etwa darum, eine Diskussion über Kryonik anzustossen oder um einen Diskurs hinsichtlich der Frage nach der Autorschaft in der Kunst? Oder dient der Markenname „Picasso“ lediglich als geschickte Strategie, um die eigene Kunst an ein breiteres Publikum zu vermarkten? Sowohl die Ambiguität in der künstlerischen Absicht als auch der semantische Overkill der Bilder sind erschöpfend, der Leseparcours selbst eine Zumutung: Wenn Bildsprache alleine nicht mehr genügend Anregung für Diskurs bietet, schlägt man lieber zu Hause ein Buch auf.