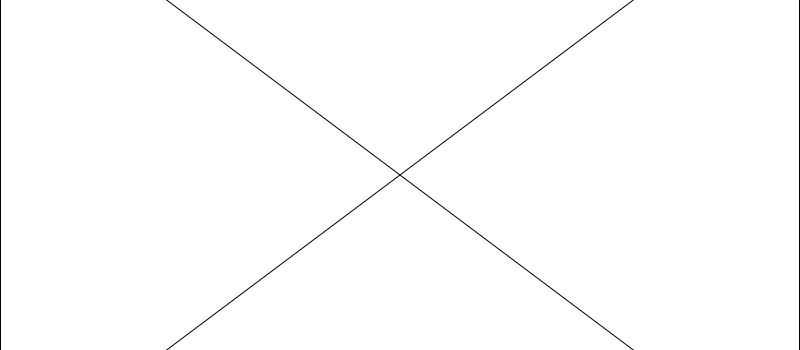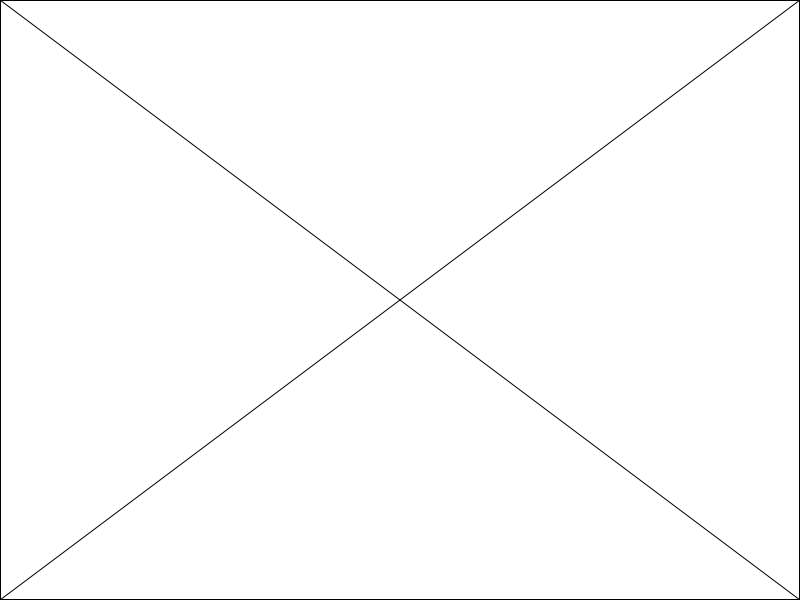Andriu Deplazes, Träger des Helvetia Kunstpreises 2017.
Soloshow an der Liste – Art Fair Basel, Warteck pp, Burgweg 15, Basel.
Hortus Botanicus. Helvetia Art Foyer, Steinengraben 25, Basel.
Donnerstag 16.00 bis 20.00 Uhr.
Bis 24. August 2017.
Spricht man Andriu Deplazes auf die merkwürdige Wolkenformation auf einem seiner Bilder an, grinst er nur. Hodler halt. Andriu Deplazes (*1993) weiß, dass er als Maler gerade in der Schweiz eine Art Welpenschutz genießt. Da darf man da auch Wolken malen, als ob neun Flugzeuge Kondensstreifen in den Himmel gezogen hätten oder wie man sie von Ferdinand Hodler kennt. Ob man ihn bei der Plattform-Ausstellung im Kunsthaus Glarus vor der Jurierung des Helvetia Kunstpreises 2017 wohl auf dem Schirm hatte? Denn Andriu Deplazes macht sich gerne rar. Am Ende seines Kunststudiums in Zürich, wo er auch geboren und aufgewachsen ist, verbrachte er ein Erasmus-Jahr in Brüssel. Danach entschied er, dort erst einmal wohnen zu bleiben, und so pendelt er nun zwischen Belgien und der Schweiz. Seine Bilder hält er lange unter Verschluss, er zeigt sie erst, wenn er absolut zufrieden ist. Während des Studiums habe er, so erzählt er, über ein Jahr ausschließlich Fische gemalt – Fische zwischen Leben und Tod. Dann nach einer Phase intensiver Arbeit änderte sich seine Bildwelt radikal. Jetzt ringen auf seinen Arbeiten die Figuren und die Landschaft um die Dominanz und haben sich auf ein einvernehmliches Patt verständigt.
Andriu Deplazes ist jemand, der sich hineinkniet. Bevor er zu malen anfing, hat er Klarinette studiert und finanzierte sich mit der Musik seinen Bachelor of Fine Arts an der Zürcher Hochschule der Künste. Er wurde mit dem Jugendpreis der Naturforschenden Gesellschaft Zürich ausgezeichnet und Langstreckenläufer war er auch. Malerei muss Spaß machen, ist er überzeugt. Dem Betrachter und ihm selbst sowieso. Schließlich hat Andriu Deplazes Alternativen.
Seine Bilder fangen mit Zeichnungen an. Oft sind es alltägliche Beobachtungen oder Details, die ihm ins Auge fallen. Kunsthistorische Referenzen kommen vor. Es lassen sich aber auch Einflüsse aus der Gegenwartskunst wie Georg Baselitz und Daniel Richter erkennen oder Parallelen zu den apokalyptischen Szenen einer Miriam Cahn. Nach einem Besuch in der Tate Britain bei den Präraffaeliten und deren Opheliamotiven, entstand ein Bild, auf dem ein weiblicher Körper in einer Flusslandschaft oder einem Teich dargestellt ist. Das haarlose Wesen ist in einer merkwürdigen Bewegung festgehalten, mit der rechten Hand scheint es nach etwas greifen zu wollen, doch die Schwerkraft ist zu groß. Nur: so fallen Leiber nicht. Deplazes‘ Körper entsprechen weder gängigen Schönheitsidealen noch der Anatomie. Mal sind die Beine zu lang, oft wirken die meist nackten Figuren wie aufgeschwemmt und hinterlassen einen verletzlichen, aber zugleich aggressiven Eindruck. Oft lässt sich noch nicht einmal sagen, welches Geschlecht sie haben. Diese Unentschiedenheit hat etwas mit Andriu Deplazes Weigerung zu tun, erzählen zu müssen, nur weil er figurativ malt. Mehr aber hat diese Unentschiedenheit mit spezifisch malerischen Entscheidungen zu tun. Die Körper bilden ein Gegengewicht zu der sie umgebenden Natur oder Landschaft.
Die Dynamik, die viele seiner Bilder auszeichnet, entsteht nicht zuletzt mittels durchdachter Farbkompositionen. Deplazes schichtet die Farbe, er nimmt weg, manche Töne treten wie bei der unbetitelten Arbeit in der Ausstellung „Hortus Botanicus“ nach vorne, andere nach hinten, so dass ein Kippeffekt entsteht. Feuerzungen scheinen an der Pflanze zu lecken. Hinzu kommt, dass Deplazes, seiner Farbe floureszierende Pigmente zufügt. Dieser Stich ins Grelle, Neonfarbene ist für ihn auch eine Reaktion auf unsere Wahrnehmung von Bildern, die weniger durch Abbildungen in Katalogen als durch den Bildschirm beeinflusst wird. Es dauert jedenfalls bis die verschiedenen Komponenten eines Bildes zueinander finden. Zwei bis drei Monate arbeite er an einem Bild, sagt Deplazes. Diese Zeit braucht es, nicht nur, weil Ölbilder trocknen müssen, sondern weil die Arbeiten sich so ihren eigenen Kontext schaffen. Witz, Schwere und Tiefe gehören am Ende jedenfalls dazu.